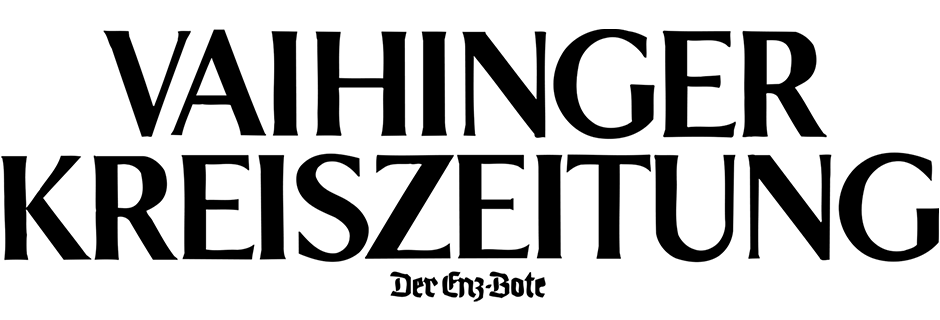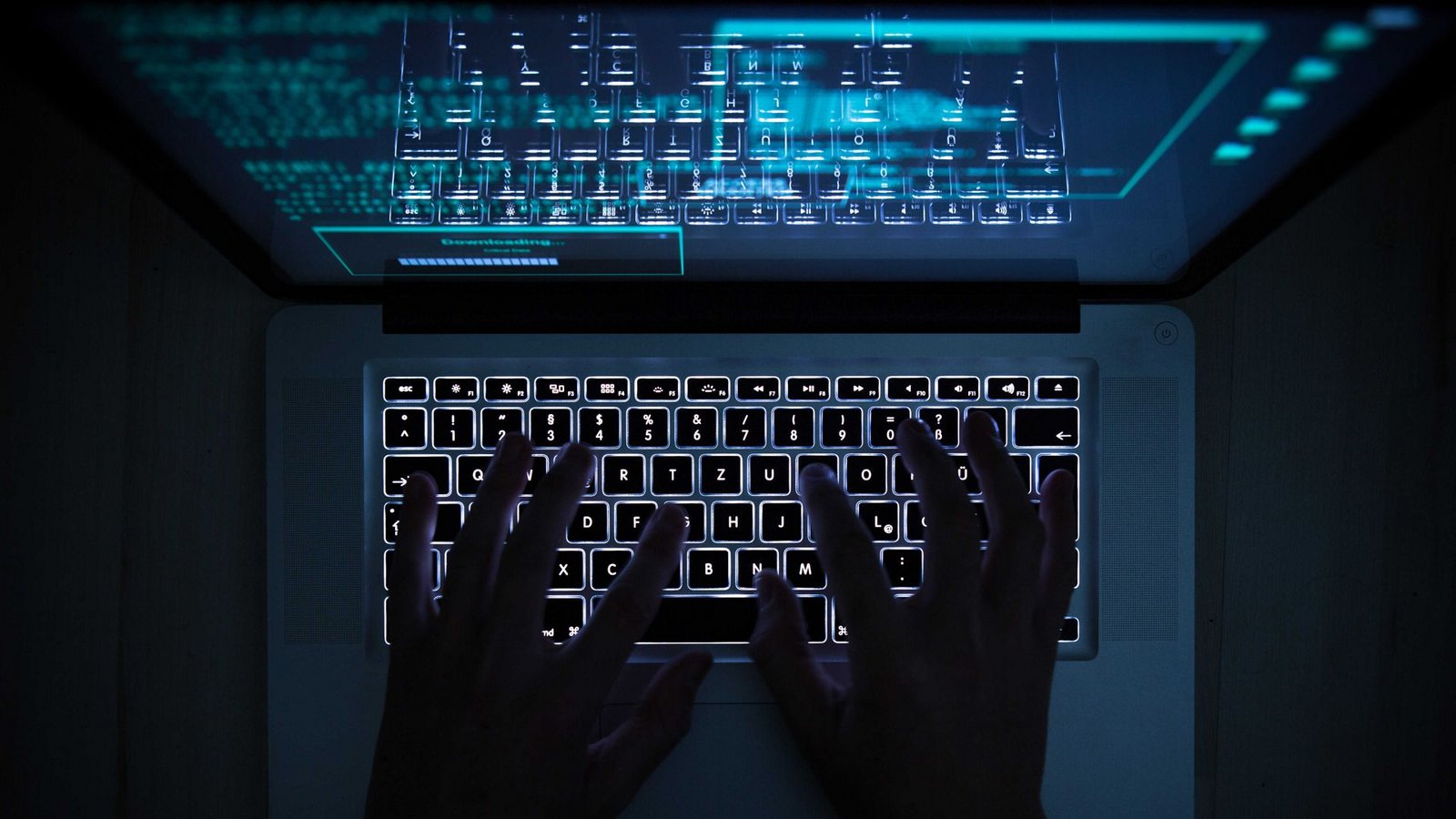Der Staat darf Handys und Computer überwachen – aber nur wenn es um die Verfolgung besonders schwerwiegender Straftaten geht. Das hat das Bundesverfassungsgericht nun entschieden. Es ging um eine Klage gegen den Einsatz sogenannter Staatstrojaner – also von Software, die Strafermittler heimlich auf Geräten installieren können, um dort zum Beispiel die Chats in Nachrichten-Apps wie „WhatsApp“ mitzulesen.
Das ist, keine Frage, ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Das Verfassungsgericht kam nun zu dem Schluss, dass das aber bei schweren Straftaten gerechtfertigt sein kann. Damit hat das Gericht den Gesetzgeber zwar grundsätzlich bestätigt. Aber er hat ihm auch deutliche Grenzen aufgezeigt.
Nur für besonders schwere Fäle
Denn die Richter entschieden auch, dass diese Art von Überwachung in Teilen dann verfassungswidrig ist, wenn sie zur Verfolgung weniger schwerwiegender Straftaten eingesetzt wird. Nämlich solcher, für die eine Höchstfreiheitsstrafe von drei Jahren oder weniger gilt. Das sollte sich die aktuelle Bundesregierung zu Herzen nehmen, wenn sie über neue Vorhaben dieser Art nachdenkt.
Es ist eine deutliche Mahnung aus Karlsruhe, nach der das Gesetz nun angepasst werden muss – und die geht eben auch an die aktuellen Regierungsparteien. Immerhin waren es Union und SPD, die 2017 das Gesetz zum Staatstrojaner beschlossen, das nun in Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde.
Für die kommende Legislatur hat sich die Koalition wieder einiges vorgenommen, was Datenschützer besorgt. Union und SPD wollen zum Beispiel den Katalog von Straftaten erweitern, bei deren Verfolgung die Telekommunikation überwacht werden darf. Nach der Entscheidung aus Karlsruhe wäre es wohl angemessener zu prüfen, ob die Liste nicht eher kürzer als länger werden müsste. Es wird Zeit, dass Union und SPD für solche Fragen mehr Fingerspitzengefühl entwickeln.