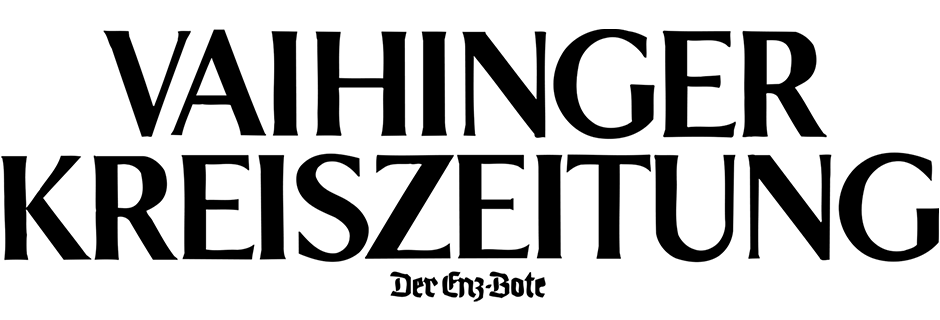1994 brachte Kelly Reichardt ihren ersten Film „Rivers of Grass“ in die Kinos, ein mit bescheidenen Mitteln entstandenes Frauenporträt, das zwar eher ein kleines Publikum anlockte, aber von der Kritik und beim Sundance Film Festival sowie der Berlinale gefeiert wurde. Ähnlich verhält es sich mit allen Werken der Amerikanerin seither: für den Mainstream ist das selten etwas, doch in der Nische hat sie mit Filmen wie „Wendy and Lucy“, „Meek’s Cutoff“, „Certain Women“ oder „First Cow“ eine treue Fanschar gefunden. Und die wächst von Film zu Film, so dass Reichardt, die zum Geldverdienen am Bard College unterrichtet, jüngst mit „Showing Up“ erstmals im Wettbewerb in Cannes vertreten war.
Beim Filmfestival in Locarno, das vom 3. bis 13. August am Lago Maggiore stattfindet, wird der 58-jährigen nun der Pardo d’onore verliehen.
Ms. Reichardt, Sie erhalten beim Filmfestival in Locarno in diesem Jahr einen Ehrenpreis für Ihr Lebenswerk. Was bedeutet Ihnen diese Ehrung?
Sie erinnert mich vor allem daran, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und natürlich lenkt so ein Preis ein wenig Aufmerksamkeit auf das Œuvre, mit dem vermutlich viele Menschen nicht vertraut sind. In Locarno werden meine beiden Filme „Meek’s Cutoff“ und „Night Moves“ gezeigt, und ich freue mich wirklich sehr, dass diese Werke nun von Menschen gesehen werden, die sie mutmaßlich bislang nicht kannten.
Blicken Sie selbst gerne auf Ihr Werk?
Eigentlich nicht. Wenn ich mit einem Film fertig bin, dann lasse ich ihn hinter mir.
Ihre Filme sind nichts für ein Massenpublikum, doch in den letzten Jahren scheint die Aufmerksamkeit für ihre Arbeit stetig zu wachsen. Mit Ihren jüngsten Filmen waren Sie etwa im Wettbewerb in Berlin und zuletzt auch in Cannes vertreten. Wie macht sich diese Veränderung für Sie bemerkbar?
Es ist immer nett, zu einem Festival eingeladen zu werden, und ich fand es sehr aufregend, meinen neuen Film „Showing Up“ in Cannes dem französischen und internationalen Publikum präsentieren zu dürfen. Aber Cannes bedeutet auch viel Stress im Vorfeld. Da dreht sich dann vieles um die Garderobe und den roten Teppich oder die Frage, ob die Schuhe der Kleiderordnung des Festivals entsprechen. Wenn dann im Saal – ob in Cannes oder bei anderen Erstaufführungen – die Lichter ausgehen, heißt das für mich, dass der Entstehungsprozess eines Films endgültig abgeschlossen ist. Dann kann ich endgültig nichts mehr ändern. Mich macht das immer sehr müde. Ich glaube, in den meisten Weltpremieren meiner Filme bin ich irgendwann eingenickt.
Sie drehen seit 30 Jahren Filme. Wurde das angesichts der Veränderungen, die die Branche durchmacht, über die Jahre immer schwieriger?
Das Gerede über die Krise der Branche und vor allem des Independent-Kinos höre ich eigentlich, seit ich angefangen habe, als Regisseurin zu arbeiten. Das Ganze hängt also offensichtlich schon sehr lange am seidenen Faden. Aber was mich interessiert, ist die eigentliche Arbeit an einem Film: das Schreiben des Drehbuchs, die Gedanken, die ich mir über die Bilder und die Einstellungen mache, das Sounddesign, all diese Dinge. Damit ist mein Kopf voll genug, deswegen kann ich ihn mir nicht auch noch über die Filmindustrie zerbrechen. Darüber denke ich wirklich eher selten nach.
Sie schneiden Ihre Filme stets selbst. Weil Sie ungern die kreative Kontrolle aus der Hand geben?
Angefangen hat das damals damit, dass ich mir einfach keinen Editor leisten konnte. Also habe ich mir das alles selbst angeeignet und in die eigenen Hände genommen. Dabei habe ich unglaublich viel gelernt über die Struktur eines Films und darüber, wie Bewegung, Timing oder Einstellungen funktionieren. Mein Kameramann und Chris Blauvelt und ich denken schon beim Drehen immer auch an den späteren Schnitt. Das erspart einem später viel Arbeit.
In vielen Ihrer Filme spielt Michelle Williams die Hauptrolle, auch in Ihrem neusten wieder. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung?
Zum ersten Mal getroffen haben müssten wir uns vor 15 Jahren, aber an die Details erinnere ich mich nicht. Aber ich habe noch immer den Moment im Kopf, als mir bewusst wurde, wie fantastisch sie wirklich als Schauspielerin ist. Das war in einer Lebensmittelladen-Szene bei unserem ersten gemeinsamen Film „Wendy and Lucy“. Die Gleichzeitigkeit, mit der sie da einerseits etwas Äußerliches tat – nämlich einen Apfel aussuchen – und parallel innerlich einem Gedanken nachhing, und beides zu gleichen Teilen für die Kamera sicht- und spürbar war, war beeindruckend.
Williams und Blauvelt sind nicht die Einzigen, mit denen Sie immer wieder zusammenarbeiten. Wie wichtig sind langjährige Kollaborationen für Sie?
Es ist auch schön, neue Erfahrungen mit neuen Menschen zu machen. Aber Vertrauen ist für die Arbeit am Set unerlässlich, da hilft es, wenn man sich gut kennt. Meistens weiß man auch schon im Vorfeld, worüber man sich streiten wird, lange bevor es so weit ist.